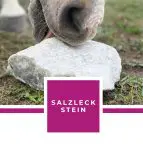Es war ein ganz normaler Trainingstag. Dein sonst so entspannter Vierbeiner beginnt beim Angaloppieren plötzlich zu husten – erst nur ein oder zwei Mal, dann immer häufiger. "Nur ein bisschen Staub", denkst du dir und reitest weiter. Erst Wochen später wird klar: Dein Pferd leidet bereits an einer chronischen Atemwegserkrankung.
Klingt wie eine schlecht ausgedachte Gute-Nacht-Geschichte? Ist es leider nicht. Solche Szenarien sind traurige Realität – denn nach Lahmheiten sind Atemwegserkrankungen beim Pferd die zweithäufigste Gesundheitsbaustelle. Über 50 % aller Stallpferde haben damit zu tun – und das, obwohl die Haltung heute so modern ist, dass die KI vermutlich bald das Heu servieren kann. Das Problem: Viele Warnsignale werden einfach übersehen oder mit einem Schulterzucken ignoriert.
Mit diesem Artikel möchte ich daher aufräumen, dir zeigen wie du die stillen Hilferufe der Pferdelunge erkennst, Atemwegserkrankungen rechtzeitig aufdeckst und im besten Fall sogar verhinderst.

Wie atmet ein gesundes Pferd eigentlich?
Bevor wir in die Welt der Huster und Keucher eintauchen, werfen wir erst mal einen Blick auf das Meisterwerk der Natur: die Pferdelunge. Die Anatomie ist eigentlich recht simpel. Luft strömt durch die Nüstern in die Luftröhre, von dort in die beiden Lungenflügel und in die feinen Bronchien bis hin zu den winzigen Lungenbläschen.
Das Besondere dabei: Pferde sind sogenannte "obligate Nasenatmer". Sie können ausschließlich durch die Nase atmen, nie durch das Maul so wie wir Menschen. Einerseits clever für sportliche Höchstleistungen, andererseits fatal, wenn irgendwas die Nasenwege dicht macht.
Deshalb hat sich die Natur für die Pferdelunge ein geniales Reinigungssystem ausgedacht: Millionen von Flimmerhärchen in den Atemwegen arbeiten wie winzige Besen und transportieren eingeatmete Partikel nach draußen. Zusätzlich produziert die Schleimhaut einen klebrigen Schleim, der Staub und Keime einfängt. Dieses System ist so effektiv, dass es sogar bei extremer Belastung funktioniert.
Aber wehe, das System kommt aus dem Takt. Staub im Stall, Schimmel im Heu oder andere Luftverderber bringen das empfindliche Gleichgewicht ins Wanken – und schon hustet dein Pferd wie ein Kettenraucher nach dem Dauerlauf.
Normalwerte für gesunde Pferde:
- Atemfrequenz in Ruhe: 8-16 Atemzüge pro Minute
- Atemgeräusche: kaum hörbar, gleichmäßig
- Nasenausfluss: maximal klarer, dünner Schleim
- Husten: sehr selten
Die häufigsten Atemwegserkrankungen beim Pferd
Equines Asthma (ehemals COB/RAO)
Equines Asthma ist der moderne Sammelbegriff für das, was früher als COB (Chronisch obstruktive Bronchitis), RAO (Recurrent Airway Obstruction) oder schlicht "Dämpfigkeit" bekannt war. Diese Atemwegserkrankungen wurden deshalb unter einem Begriff zusammengefasst, weil sie trotz unterschiedlicher Auslöser zu ähnlichen Symptomen und Verläufen führen. Equines Asthma ist quasi der Oberbegriff für Erkrankungen, bei denen es zu chronisch entzündeten Atemwege, verengten Bronchien oder einer erhöhten Schleimproduktion kommen kann.
Die Symptome variieren je nach Schweregrad:
- Leichtes Equines Asthma: Gelegentlicher Husten, besonders zu Arbeitsbeginn, leichter klarer Nasenausfluss, etwas weniger Leistung
- Mittelschweres Equines Asthma: Häufigerer Husten, schleimiger Nasenausfluss, deutlicher Leistungsabfall, erste Atemgeräusche
- Schweres Equines Asthma: Permanente Atemnot auch in Ruhe, sichtbare Bauchatmung mit "Dampfrinne", rasselnde Atemgeräusche, starker Leistungsabfall
Die Hauptverursacher sind:
- Staubpartikel aus trockenem Heu und Stroh
- Schimmelsporen aus schlecht gelagertem Futter
- Ammoniak aus Stallböden
- Feinstaub von Reitböden/Ausläufen
Das Tückische: Einmal entwickelt, bleibt Equines Asthma leider meist ein lebenslanger Begleiter. Mit der richtigen Behandlung und Haltung können betroffene Pferde aber durchaus ein normales Leben führen.
Infektiöse Erkrankungen und Allergische Reaktionen
Hier wird’s viral – im wahrsten Sinne des Wortes. Infektiöse Atemwegserkrankungen sind nämlich die „Grippewellen“ des Reitstalls. Ein Pferd niest, zehn Pferde husten:
- Pferdegrippe (Influenza): Hochansteckend, typische Symptome sind Fieber, trockener Husten und Nasenausfluss
- Pferdeherpes (EHV): Kann neben Atemwegssymptomen auch neurologische Ausfälle verursachen
- Druse: Bakterielle Infektion mit charakteristischen Lymphknotenschwellungen
Diese Erkrankungen verbreiten sich vor allem rasant auf Turnieren oder in Reitställen. Daher sind Quarantänemaßnahmen essentiell – denn ein erkranktes Pferd kann binnen Stunden einen ganzen Stall anstecken.
Allergische Reaktionen sind dagegen die heimlichen Störenfriede:
- Heustauballergie: Eigentlich eine Reaktion auf Schimmelsporen, nicht auf Heustaub
- Pollenallergie: Verursacht den gefürchteten "Sommerhusten"
- Futtermilbenallergie: Tritt bei schlecht gelagertem Futter auf
Warum Pferde heute häufiger an Husten & Co. leiden
Die moderne Pferdehaltung ist Fluch und Segen in einem. Einerseits bietet sie Schutz und Komfort, andererseits schafft sie neue Probleme für die Atemwege. Denn das Stallklima wird leider oft zum wahren Krankmacher: Ammoniak aus Urin ist für die Lunge etwa so angenehm wie Pfefferspray beim Yoga. Dazu kommt noch trockenes Heu, das beim Schütteln eine eigene Staubwolke erschafft. Einmal lüften? Naja, der Spalt unter der Tür zählt leider nicht als „guter Luftaustausch“.
Hinzu kommen dann häufig noch diverse Fütterungsfehler: Heu ohne ausreichende Trocknung, die Lagerung von Futter in feuchten Räumen mit Schimmelgefahr und die Verfütterung von staubigem oder muffigem Raufutter. Dazu kommt Bewegungsmangel - ein sehr unterschätzter Risikofaktor. Denn die Lunge braucht Training genauso wie die restlichen Muskeln. Pferde, die zu wenig bewegt werden, haben schwächere Atemwege und sind anfälliger für Erkrankungen.
Und zu guter Letzt wären da noch die Jahreszeiten. Im Winter führen geschlossene Ställe, mit wenig Frischluft und mehr Zeit in der Box zu einer erhöhten Belastung. Das Frühjahr bringt den Pollenflug und die Umstellung von Heu auf Gras mit sich, während der Sommer mit Hitze und Trockenheit um die Ecke kommt.

Behandlung: Was hilft wieder durchzuatmen?
Spätestens wenn dein Pferd seit einer Woche hustet, als wolle es auf ein Casting für Tierarzt-Werbespots, ist der Moment gekommen: Ruf den Profi! Was du ansonsten noch tun kannst? Starte ein Husten-Tagebuch! Klingt nerdig, ist aber Gold wert. Notiere dir: Wann hustet mein Pferd? Beim Reiten? Beim Fressen? Beim Wetterumschwung? Je genauer du bist, desto besser und schneller kann dein Tierarzt eine Diagnose stellen.
Nach der Untersuchung (mit Stethoskop, Endoskop usw.) kommt meist eine medikamentöse Therapie. Aber keine Sorge: Pferde müssen nicht sofort in der Pillenhölle landen. Es gibt viele begleitende Maßnahmen, die bei der Behandlung helfen, ohne gleich den Medikamentenschrank zu sprengen:
- Hustenkräuter wie die Alantwurzel - lösen den Schleim
- Eibisch – beruhigt gereizte Schleimhäute
- Spitzwegerich – wirkt antibakteriell
- Solekammern – lindern chronische Entzündungen durch das Einatmen von Salzluft
Wenn du es lieber einfach und kompakt haben möchtest, dann schau dir mein Futtermittel Lunge Frei. Das vereint alles, was dein Pferd braucht, um wieder richtig durchatmen zu können.
Außerdem gibt es noch die Inhalationstherapie. Dabei bringen moderne Ultraschallvernebler die Wirkstoffe dahin, wo sie auch gebraucht werden – tief rein in die Bronchien. Kochsalzlösungen befeuchten und reinigen dann noch zusätzlich, während beispielsweise Sole schleimlösend wirken kann. Bei mir kannst du so ein Inhalationsgerät sogar mieten. Schau dazu gerne gleich mal im Shop vorbei!
Das A und O der Atemwegsgesundheit
Willkommen im Club der „Ich will gar nicht erst, dass mein Pferd hustet“-Denker. Sehr gute Entscheidung. Lass uns daher gleich mal mit dem Feind Nummer eins im Stall loslegen - dem Staub.
Heu bedampfen oder wässern ist wie eine Anti-Staub-Versicherung - es reduziert Staub und Keime um bis zu 98%. Jedoch ist hier auch gleichzeitig Vorsicht geboten. Denn beim Bedampfen wird ein Teil der Proteine im Heu zerstört. Zudem muss man es nach dem Vorgang zügig verfüttern - innerhalb von 12 - 24 Stunden. Ansonsten läuft man Gefahr das Heu in eine Bakterienhochburg zu verwandeln.
Späne oder Pellets als Einstreu sollten staubigem Stroh vorgezogen werden. Separate Futterräume sorgen dafür, dass Heu und Stroh nicht im direkten Stallbereich lagern und feuchtes Ausmisten bindet den Staub. Alternativ kannst du auch misten, wenn die Pferde nicht im Stall sind und warten, bis sich alles wieder gesetzt hat.
Was das Stallklima betrifft, braucht es eine feine Balance zwischen Frischluft und Behaglichkeit. Das heißt im Klartext keine arktische Zugluft, aber auch keine muffige Sauna. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 80 %. Denn zu trockene Luft reizt die Schleimhäute und zu feuchte ist die Einladung zur Schimmelparade.
Außerdem: Bewegung! Und nein, damit ist kein Salatschleuder-Longieren oder auf dem Paddock rumstehen gemeint. Tägliches Training mit Verstand stärkt die Atemmuskulatur, der Weidegang bietet die beste Luftqualität, und auch im Winter sollten Pferde regelmäßig an die frische Luft.
Fazit: Kleine Warnsignale - große Wirkung
Atemwegserkrankungen beim Pferd sind leider kein exotisches Phänomen, sondern eine Dauerbaustelle in vielen Ställen. Das Husten-Szenario vom Anfang? Kein Märchen, sondern eher ein Klassiker. Dabei ist Früherkennung der Schlüssel zum Erfolg.
Daher hier nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
- Husten ist nie normal! Egal wie charmant dein Pferd ihn vorträgt.
- Staubfrei ist der neue Luxus. Du brauchst keinen krassen Stall, nur gute Luft.
- Bewegung ist ein Muss. Faulenzen kann die Lunge nicht.
- Geduld, Geduld, Geduld. Chronische Huster brauchen Zeit, Konsequenz und Mitgefühl.
Dein Pferd verlässt sich darauf, dass du seine stillen Signale verstehst. Beobachte daher genau, handle schnell und scheue dich nicht, professionelle Hilfe zu holen. Eine gesunde Pferdelunge ist die Basis für Leistung, Wohlbefinden und ein langes, glückliches Leben.
Wichtiger Hinweis: Bei Verdacht auf eine Atemwegserkrankung solltest du immer einen Tierarzt konsultieren. Eine fundierte Diagnose und individuell abgestimmte Therapie sind unerlässlich für den Behandlungserfolg.